
Die Folgen des Klimawandels verursachen in Deutschland bereits heute Kosten in Milliardenhöhe.
Studien prognostizieren, dass die wirtschaftlichen Schäden bis 2050 je nach Szenario zwischen 280 und 900 Milliarden Euro betragen werden.
Widererwartend sind mittelständische Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden 2025 nicht dazu verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Sie können dies jedoch auf freiwilliger Basis tun.
Wie sich der Klimawandel auf Deutschland auswirkt
Hitzewellen, Dürren, Starkregen, Sturmfluten und Hochwasser – der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. Durchschnittlich steigen die Temperaturen. Extremwetterereignisse werden häufiger und intensiver.
In vielen Regionen sind die Bodenschichten massiv ausgetrocknet. Wälder sind durch Trockenheit, Stürme und Schädlinge wie den Borkenkäfer stark gefährdet. Denn durch die milden Winter können viele Schädlinge leichter überleben. Starkregen und Überschwemmungen führen zu erheblichen Schäden an Infrastruktur und Gebäuden. Der Klimawandel belastet die Menschen sowie heimische Tier- und Pflanzenarten. Langfristig verändert er ganze Ökosysteme.
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft in Deutschland
Auch wirtschaftlich spürt Deutschland die Folgen. Schäden durch Extremwetterereignisse verursachen Kosten in Milliardenhöhe. Versicherungen geraten unter Druck. Betriebe leiden unter Produktionsausfällen. Viele Unternehmen müssen sich auf gestörte Lieferketten einstellen. Nahezu alle deutschen Unternehmen sind direkt oder indirekt von den Folgen des Klimawandels betroffen.
Wie können Betriebe auf Extremwetter reagieren?
Zudem wächst der Anpassungsbedarf bei Städten und Gemeinden. Das gilt etwa für den Ausbau von Hitzeschutz, klimaresilienter Infrastruktur und einem besseren Wassermanagement. Insgesamt wird deutlich, dass der Klimawandel nicht nur eine ökologische, sondern auch eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung für Deutschland darstellt.
Prognose: Einkommensveränderungen in Folge des Klimawandels im Jahr 2049 im Vergleich zu einer Wirtschaft ohne Klimawandel
Besonders eindrücklich weist eine Studie des Potsdam Institute for Climate Impact Research (2024) nach, dass alle Wirtschaftszweige vom Klimawandel betroffen sind. Die Forschenden haben hierfür Einkommensveränderungen analysiert und prognostiziert, die weltweit durch die Auswirkungen des Klimawandels zu erwarten sind. Die Veränderungen resultieren aus den bereits verursachten Emissionen. Die Grafik zeigt die unterschiedlichen regionalen Auswirkungen, die für das Jahr 2049 angenommen wurden. Damit ist jeweils die Einkommensveränderung im Vergleich zu einer Wirtschaft ohne Klimawandel gemeint. Bei deutlichen Einkommensveränderungen ist unter anderem von Anpassungen im Konsumverhalten auszugehen, die sich wiederum wirtschaftlich niederschlagen.
Hinweis: Die Grafik basiert auf der Studie des Potsdam‑Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Am 6. August 2025 wurden einzelne Kennzahlen angepasst: Der prognostizierte globale Einkommensrückgang bis zur Jahrhundertmitte liegt jetzt bei 17 statt 19 Prozent. Die ungleiche Verteilung der Schäden weltweit erweist sich nun als noch ausgeprägter: Ärmeren Regionen entstehen demnach prozentual deutlich höhere Verluste. Die Kernbotschaften – hohe Kosten und stark ungleiche Belastung – bleiben bestehen. Die genauen Anpassungen finden Sie auf der Webseite des PIK.
Das kostet der Klimawandel die deutsche Wirtschaft
Die wirtschaftlichen Schäden sind erheblich: Zwischen 2000 und 2021 entstanden in Deutschland mindestens 145 Milliarden Euro Verluste durch Extremwetter – rund 80 Milliarden allein seit 2018. Für die Zukunft fallen die Prognosen sehr unterschiedlich aus.
3 Beispiele:
- Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie prognostiziert die volkswirtschaftlichen Schäden bis 2050 auf zwischen 280 und 900 Milliarden Euro, abhängig vom Klimaszenario.
- Das Beratungsunternehmen Deloitte rechnet bis 2070 für Deutschland mit wirtschaftlichen Schäden in Höhe von 730 Milliarden Euro – wenn die Klimaneutralität nicht erreicht wird. In diesem Szenario würden etwa 470.000 Arbeitsplätze verloren gehen. In einem anderen Szenario wächst die deutsche Wirtschaft bis 2070 um 140 Milliarden Euro. Hier wurde berechnet, wie Deutschland von den wirtschaftlichen Vorteilen der Dekarbonisierung profitieren könnte. Das gilt, wenn die klimapolitischen Maßnahmen frühzeitig und erfolgreich ergriffen werden.
- Laut Report der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) 2025 liegt der erwartete Wertschöpfungsverlust zwischen 2025 und 2050 bei etwa 690 Milliarden Euro. Vor allem die Klimawirkungen in den Bereichen Gesundheit, Versicherung und Landwirtschaft haben starken Einfluss auf die Höhe der Verluste, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Dabei wirken sich nicht nur Unternehmen aus, die direkt vom Klimawandel betroffen sind. Auch ein geringeres Konsumverhalten der Bevölkerung – unter anderem auch durch höhere Lebensmittel- und Energiepreise – fließt mit ein. Weniger Konsum führt zu weniger Produktion, was zu weniger Emissionen führt. Andererseits reduzieren sich dadurch auch die Staatseinnahmen aus Steuern, während Haushalte gleichzeitig stärker auf Unterstützung angewiesen sind. Höhere Schulden könnten die Folge sein.
Rechtlicher Rahmen: Das sollten mittelständische Unternehmen wissen
Klimaschutzgesetz (KSG)
Die Klimaschutzpolitik sieht mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz vor, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden (neue Fassung: August 2024). Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein (Netto-Treibhausgasneutralität). Das heißt, es dürfen nur so viele Emissionen ausgestoßen werden, wie durch natürliche oder technische Senken gebunden werden können.
Die jährlichen Emissionsmengen für alle Bereiche bis 2030 werden weiter reduziert. Zudem gibt es Sektorziele sowie übergreifende jährliche Minderungsziele von 2031 bis 2040 in Bezug auf die Gesamtemissionen.

0%
Quelle: EY, 2025
Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
Das Klimaanpassungsgesetz (KAnG) ist ein seit Juli 2024 geltendes Bundesgesetz. Es liefert die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Dabei verpflichtet es Bund, Länder und Kommunen dazu, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, mit denen Risiken durch Hitze, Dürren, Starkregen oder Hochwasser verringert werden sollen.
Vorgesehen sind regelmäßige Klimaanpassungsstrategien auf Bundesebene sowie regionale Anpassungspläne der Länder und Kommunen. Zudem müssen Behörden Klimarisiken bei ihrer Planung systematisch berücksichtigen. Ziel ist es, Deutschland widerstandsfähiger gegen die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels zu machen und Schäden für Menschen, Umwelt und Wirtschaft zu begrenzen.

0%
Quelle: Studie im Auftrag des Umweltbundesamts, September 2024
Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen
Eine politische Maßnahme, um Nachhaltigkeit in Unternehmen zu fördern, sind Nachhaltigkeitsberichte nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Eigentlich war eine Berichtspflicht ab 2025 auch für bestimmte mittelständische Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden vorgesehen. Am 26.2.2025 hat die EU-Kommission mit dem sogenannten Omnibus-Paket nun jedoch einen Vorschlag vorgelegt, mit dem erst einmal weniger statt mehr Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind.
Im EU-Parlament wird derzeit noch darüber beraten. Bis zur Einigung, die voraussichtlich 2026 geplant ist, sind noch Änderungen möglich. Die Industrie- und Handelskammer München hat ein Merkblatt zum letzten Stand veröffentlicht (28. April 2025).
Eine Umsetzung in deutsches Recht wurde am 10. Juli 2025 angestoßen. Der Entwurf sieht eine verpflichtende Berichterstattung für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden vor. Das Gesetz wurde jedoch bisher noch nicht verabschiedet (Stand: September 2025).
Von den politischen Regelungen abgesehen, ist es für mittelständische Unternehmen auf freiwilliger Basis sinnvoll, sich bereits jetzt Gedanken darüber zu machen, wie sich die Geschäftsmodelle, Prozesse und Produkte auf das Klima auswirken. Viele Stakeholderinnen und Stakeholder achten verstärkt auf ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und richten ihre Investments nach diesen aus.
Für Unternehmen bedeutet eine freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung zusätzlichen Aufwand. Um diesen einzugrenzen und Abfragen zu vereinheitlichen, hat die Europäische Kommission am 30. Juli 2025 einen freiwilligen Berichtsstandard vorgelegt: den sogenannten „Voluntary SME Standard (VSME)“. Bei entsprechendem Ergebnis bietet eine solche freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung unter anderem die Chance, durch Klimaschutzmaßnahmen Vertrauen bei Investorinnen und Investoren zu gewinnen.
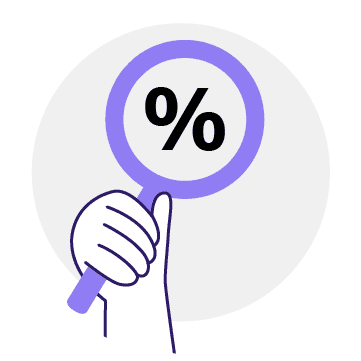
0%
Quelle: Studie ESG und Nachhaltigkeit im Mittelstand, 2025
Veröffentlichung der Nachhaltigkeitskriterien von Finanzinstituten
Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) legt fest, dass Finanzinstitute ihre Nachhaltigkeitskriterien in Entscheidungsprozessen offenlegen müssen. Dem Umgang mit Umwelt- und Klimarisiken im Kreditvergabeprozess wird dabei eine steigende Bedeutung zugemessen. Nachhaltige Finanzierung wird damit transparenter.
Grundsätzlich können im Zusammenhang mit dem Klimawandel 3 Kategorien von Risiken unterschieden werden:
- Physische Risiken umfassen die direkten Auswirkungen der Klimaerwärmung. Es wird zwischen chronischen Veränderungen und akuten Ereignissen unterschieden: Chronische Veränderungen sind zum Beispiel der Anstieg des Meeresspiegels. Akute Ereignisse umfassen beispielsweise häufigere und stärkere Extremwetterereignisse.
- Transitionsrisiken umfassen Risiken, die sich aufgrund von technologischen Neuerungen, klimapolitischen Maßnahmen wie einer CO₂-Abgabe und der Ausweitung des Emissionshandels oder aus Veränderungen des Kundenverhaltens ergeben könnten. Dazu gehören auch Risiken von wertlos gewordenen Vermögenswerten, etwa im Bereich fossiler Energie („Stranded Assets“).
- Klimabedingte Haftungsrisiken umfassen insbesondere durch Klimageschädigte geltend gemachte Forderungen gegenüber den Verursachern des Klimawandels. Beispiele sind hier die Klage eines peruanischen Bauern gegen den deutschen Energiekonzern RWE sowie der Stadt New York gegen Exxon Mobil wegen falscher Angaben zu den Folgen des Klimawandels.
Die Risiken des Klimawandels können sich auch auf die Finanzmärkte auswirken. Die Firmenkundenbetreuer und -betreuerinnen bei Ihrer Sparkasse beraten Sie gern dazu. Oder erfahren Sie mehr in der Studie „Umgang mit physischen Klimarisiken in der Finanzwirtschaft“ (Quelle: Umweltbundesamt, 2023).
Neue Chancen und Märkte durch den Klimawandel
Der Klimawandel birgt immense Risiken und hohe Kosten. Bei allen negativen Konsequenzen eröffnen sich für zukunftsfähige Unternehmen jedoch auch neue Marktchancen und die Aussicht auf eine grünere Zukunft. Denn die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist in vollem Gange. Die Marktgegebenheiten in Verbindung mit dem Klimawandel fördern die Anpassung von bestehenden Geschäftsmodellen an eine dekarbonisierte Gesellschaft, beispielsweise durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der E-Mobilität.

0%
Quelle: Umweltbundesamt, 2025
Zusätzlich entstehen neue nachhaltige Wachstums- und Innovationsmärkte, zum Beispiel der GreenTech-Markt. Neue Antworten auf den Klimawandel und andere globale Herausforderungen wie Ressourcenverknappung, Urbanisierung oder Demografie warten nur darauf, gefunden zu werden.
Bestandsaufnahme: Wie sich mittelständische Unternehmen jetzt vorbereiten können
Der Klimawandel wird zu einer der größten Herausforderungen deutscher Unternehmen. Investitionen in Anpassung und Klimarisikomanagement werden daher immer wichtiger, auch aus Haftungs- und Versicherungsgründen. Je nach Branche und Unternehmen unterscheiden sich die konkreten Risiken und Auswirkungen. Passende Maßnahmen sind daher individuell. Die folgenden Schritte können dementsprechend nur eine allgemeine Richtung und Anregungen vorgeben.
Risikoanalyse und Strategie
Analysieren Sie die Klimarisiken für Ihren Standort, Ihre Lieferketten und Ihre Produktion, zum Beispiel durch Hitzewellen, Hochwasser oder steigende Energiepreise.
Entwickeln Sie Notfall- und Krisenpläne, damit Ihr Unternehmen im Ernstfall handlungsfähig bleibt. Legen Sie eine Nachhaltigkeitsstrategie mit klaren und messbaren Klimazielen fest, etwa zur CO₂-Reduktion und Energieeinsparung.
Energie und Ressourcen
Senken Sie Ihren Energieverbrauch, beispielsweise durch den Einsatz effizienter Maschinen und eine gute Gebäudeisolierung. Nutzen Sie bevorzugt erneuerbare Energien. Prüfen Sie die Möglichkeit und Effizienz, am Standort eigenen Strom zu produzieren, zum Beispiel über eine Photovoltaikanlage.
Fördern Sie die Kreislaufwirtschaft, indem Sie Rohstoffe wiederverwenden, Abfälle reduzieren und Recyclingprozesse etablieren. Die Sparkassen unterstützen den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und beraten Sie gern zu passenden Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten.
Lieferketten und Beschaffung
Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Lieferanten auch auf Nachhaltigkeitskriterien. Prüfen Sie deren CO₂-Bilanz. Setzen Sie auf regionale Bezugsquellen, um Transportwege zu verkürzen und Abhängigkeiten vom globalen Markt zu verringern.
Diversifizieren Sie Ihre Lieferketten, damit Ihr Unternehmen bei Naturkatastrophen oder Ressourcenknappheit weniger anfällig für Ausfälle ist.
Beschäftigte und Organisation
Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden regelmäßig im klimafreundlichen Verhalten und sensibilisieren Sie sie für Nachhaltigkeit. Schaffen Sie nach Möglichkeit flexible Arbeitsmodelle, zum Beispiel Homeoffice-Lösungen, um auf Hitzetage oder Extremwetterereignisse reagieren zu können.
Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden, indem Sie Hitzeschutzpläne entwickeln, ausreichend Trinkwasser bereitstellen und das Gebäude klimafreundlich ausstatten.
Innovation und Chancen
Prüfen Sie die Entwicklung zukunftsfähiger klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen, um neue Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Nutzen Sie staatliche Förderprogramme und finanzielle Unterstützung gezielt für Investitionen in Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen, etwa Transformationsfinanzierungen. Wir beraten Sie gern.
Kooperieren Sie mit Brancheninitiativen oder Forschungseinrichtungen, um gemeinsam innovative Lösungen gegen den Klimawandel zu entwickeln.
Hätten Sie’s gewusst? Die Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den wichtigsten Finanzierern für Vorhaben zu erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und der Gebäudesanierung in Deutschland. Fast 40 Prozent der KfW-geförderten Darlehen in diesen Bereichen werden durch unsere Gruppe vergeben.
Sie möchten sich für den Klimawandel wappnen?
Häufige Fragen zu den Folgen des Klimawandels
Die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels unterscheiden sich je nach Land, Region, Branche und Unternehmen. Dazu gehören unter anderem folgende Auswirkungen:
- Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände verursachen große Schäden an Infrastruktur und Gebäuden.
- Dürren, Unwetter und Schädlingsbefall führen zu Ernteausfällen und geringerer landwirtschaftlicher Produktivität.
- Unternehmen müssen mit steigenden Kosten für Energie, Rohstoffe und notwendige Anpassungsmaßnahmen rechnen.
- Klimabedingte Schäden verursachen steigende Versicherungskosten. Bestimmte Versicherungen müssen ihre Prämien erhöhen.
- Naturkatastrophen und Ressourcenknappheit bringen internationale Lieferketten ins Wanken.
- In einigen Regionen gehen Tourismuszahlen zurück, während andere klimatisch attraktivere Orte profitieren.
- Durch Hitzewellen und neue Krankheiten steigen die Gesundheitskosten für Staaten und Unternehmen.
- Beschäftigte leiden unter Hitzestress, was die Produktivität in vielen Branchen verringert.
- Immobilien in Küsten- und Hochwasserregionen verlieren an Wert und werden schwerer verkäuflich.
Einige Beispiele:
- CO₂-Bepreisung und Emissionshandel: Unternehmen zahlen für ihre Treibhausgasemissionen, was klimafreundliche Technologien attraktiver machen soll.
- Förderung erneuerbarer Energien: Investitionen in Wind-, Solar- und Wasserkraft senken die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
- Mehr Energieeffizienz: Modernisierung von Gebäuden, Maschinen und Produktionsprozessen reduziert den Energieverbrauch.
- Kreislaufwirtschaft stärken: Recycling, Reparatur und Wiederverwendung von Rohstoffen schonen Ressourcen.
- Klimafreundlichere Landwirtschaft: Die Förderung ökologischer Anbaumethoden, Humusaufbau und die Reduzierung von Methanemissionen sowie weniger Tierhaltung (Beispiel Niederlande) sollen die Landwirtschaft klimafreundlicher machen.
- Anpassungsstrategien: Investitionen in klimaresiliente Infrastruktur und Schutzmaßnahmen gegen Extremwetter sollen die Anpassung erleichtern.
- Forschung und Innovation: Neue klimafreundlichere Technologien sollen gefördert werden.
In Deutschland ist der Industriesektor insgesamt für etwa ein Viertel der Gesamtemissionen verantwortlich (Quelle: WWF Deutschland und Öko-Institut e. V., 2023). Die Industrie trägt dabei in unterschiedlicher Hinsicht zum Klimawandel bei:
- Hoher Energieverbrauch: Industrieanlagen benötigen enorme Mengen an Energie, die oft noch aus fossilen Brennstoffen stammt.
- Treibhausgasemissionen: CO₂ aus verschiedener industrieller Produktion heizt die Erderwärmung an.
- Ressourcenverbrauch: Der Abbau und die Verarbeitung von Rohstoffen verursachen zusätzliche Emissionen und Umweltbelastungen.
- Abfälle und Schadstoffe: Industrieprozesse setzen nicht nur CO₂, sondern auch andere klimaschädliche Gase wie Methan oder Lachgas frei.
- Transport und Lieferketten: Der weltweite Güterverkehr für Industrieprodukte verursacht weitere Emissionen.
Gleichzeitig kann die Industrie durch neue Technologien, Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energien eine wichtige Rolle bei der Lösung spielen.
Die emissionsintensivsten Anlagen werden in Deutschland laut Bericht von WWF und Öko-Institut e. V. in der Eisen- und Stahlindustrie betrieben (Quelle: WWF Deutschland und Öko-Institut e. V., 2023).
Unternehmen haben viele Möglichkeiten, aktiv zum Klimaschutz beizutragen:
- Energieeffizienz steigern: Gebäude, Maschinen und Prozesse modernisieren, um weniger Energie zu verbrauchen.
- Erneuerbare Energien nutzen: Strom aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft beziehen oder selbst produzieren.
- Emissionen messen und reduzieren: CO₂-Bilanzen erstellen, Klimaziele setzen und systematisch den Ausstoß senken.
- Nachhaltige Lieferketten aufbauen: Partnerunternehmen auswählen, die umweltfreundlich produzieren und transportieren.
- Kreislaufwirtschaft fördern: Produkte langlebig gestalten, recyceln und Ressourcen wiederverwenden.
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden: Schulungen und Programme starten, um klimafreundliches Handeln im Alltag zu fördern.
- Innovationen entwickeln: In klimafreundliche Technologien und Dienstleistungen investieren.
- Transparenz schaffen: Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen und Fortschritte offenlegen.
Der Klimawandel trifft bestimmte Branchen besonders stark. In der Landwirtschaft führen Dürren, Überschwemmungen und Schädlingsbefall zu sinkenden Erträgen und gefährden die Ernährungssicherheit. Versicherungen sehen sich mit steigenden Schadenssummen durch Extremwetterereignisse wie Stürme, Fluten oder Brände konfrontiert, was die gesamte Branche unter Druck setzt.
Auch der Tourismus ist betroffen, da Regionen mit Wasserknappheit, Hitze oder häufigen Naturkatastrophen an Attraktivität verlieren, während andere Gebiete profitieren. In der Energieversorgung entstehen Risiken unter anderem für die Wasserkraft durch Trockenperioden. Aber auch Stromnetze und Anlagen werden zunehmend durch Extremwetter beschädigt, während der Kühlbedarf im Sommer steigt.
Die Bauwirtschaft muss ihre Infrastruktur widerstandsfähiger machen, etwa durch hitzeresistente Materialien oder Hochwasserschutz. Der Transport- und Logistiksektor leidet unter unterbrochenen Lieferketten und höheren Kosten durch klimabedingte Schäden und neue Klimaschutzauflagen. Schließlich ist auch das Gesundheitswesen betroffen, da Hitzewellen, Luftverschmutzung und neu auftretende Krankheiten die Belastung für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme deutlich erhöhen.
Der Klimawandel führt in der Landwirtschaft zu häufigeren Dürren, Überschwemmungen und Ernteausfällen. Unvorhersehbare Wetterextreme erschweren die Planung und verringern die Produktivität. Schädlings- und Krankheitsbefall nimmt durch wärmere Temperaturen und milde Winter zu. Einige Regionen verlieren ihre Anbauflächen, während andere neue Möglichkeiten gewinnen. Insgesamt steigt die Unsicherheit.
Laut einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen machen Agrar- und Lebensmittelsysteme etwa ein Drittel der globalen, vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen aus. Das gilt einschließlich landwirtschaftlicher Produktion, Landnutzungsänderungen wie Abholzung sowie entlang der gesamten Lieferkette – vom Acker bis zum Konsumenten und der Konsumentin.
Durch die Tierhaltung entstehen große Mengen an Methan, einem besonders klimaschädlichen Gas. Lachgas aus landwirtschaftlich genutzten Bögen verstärkt die Erderwärmung zusätzlich. Abholzung für Ackerflächen und Weiden verringert wichtige CO₂-Speicher wie Wälder. Zudem verursachen landwirtschaftliche Maschinen, Transporte und Bewässerungssysteme weitere Emissionen.
Es ist wichtig, gegen den Klimawandel vorzugehen, weil er das ökologische Gleichgewicht bedroht und die Lebensgrundlagen von vielen Menschen und Tieren gefährdet. Steigende Temperaturen und Extremwetterereignisse führen zu Ernteausfällen, Wasserknappheit und Gesundheitsrisiken. Küstenregionen und ganze Lebensräume könnten durch den Meeresspiegelanstieg unbewohnbar werden, was zu Migration und Konflikten führt.
Auch die Wirtschaft leidet unter hohen Schäden und Unsicherheiten. Durch rechtzeitiges Handeln können wir die ökologischen und ökonomischen Folgen abmildern, Ressourcen schonen und eine lebenswerte Zukunft sichern.


