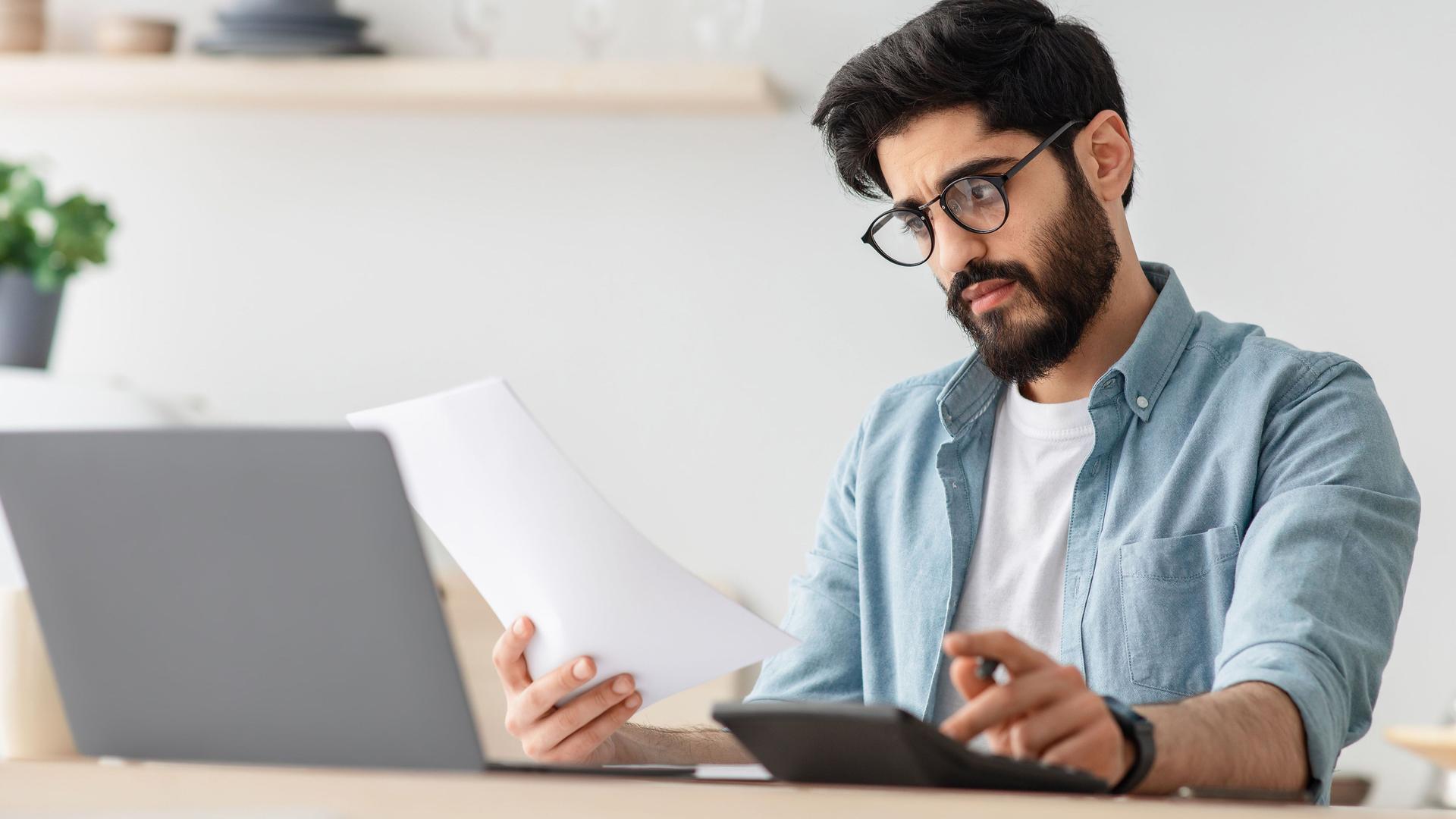Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) wäre eine staatliche Geldleistung für alle – unabhängig vom Bedarf. Sie würde verschiedene Sozialleistungen ersetzen.
Befürwortende erwarten mehr Sicherheit, weniger Bürokratie und mehr persönliche Freiheit.
Kritikerinnen und Kritiker sehen hohe Kosten, eine sinkende Arbeitsmotivation und Risiken für die Wirtschaft.
Was ist das bedingungslose Grundeinkommen?
Verschiedene Umfragen zeigen, dass in Deutschland viele Menschen für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) sind. Seit einigen Jahren diskutieren auch Politikerinnen und Politiker immer wieder darüber. Das Konzept dahinter: Jeder und jede mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland soll monatlich einen gesetzlich festgelegten Betrag vom Staat erhalten – unabhängig von ihrem Beschäftigungsstatus oder Einkommen. Ohne Bedingungen. Ohne Gegenleistung. Ohne den Zwang zu arbeiten. Je nach Modell bereits anteilig von Geburt an.
Das Grundeinkommen trennt damit Arbeit und Einkommen voneinander. Damit könnten andere soziale Leistungen entfallen. Diskutiert wird dabei etwa das Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Wohngeld oder das Kindergeld.
Vergleich: Diese unterschiedlichen Modelle gibt es
Dabei gibt es bisher kein einheitliches Konzept. Die Auswirkungen hängen stark davon ab, wie das Modell ausgestaltet ist:
- Wie hoch ist das monatliche Grundeinkommen?
- Welche Sozialleistungen würden im Gegenzug entfallen?
- Und vor allem: Wie lässt sich das Ganze finanzieren?
Viele Argumente – ob dafür oder dagegen – greifen nur, wenn man diese Faktoren klar definiert.
Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist bereits ein paar Jahre her: Ein Gutachten im Auftrag des Bundesfinanzministeriums hat 2021 berechnet, was ein monatliches BGE von 1.208 Euro für Erwachsene und 684 Euro für Kinder kosten würde. Ergebnis: Rund 900 Milliarden Euro pro Jahr – nach Abzug vieler bestehender Sozialleistungen, die dann wegfallen würden. Diese Summe müsste natürlich irgendwo herkommen. Die Finanzierung ist damit eine der Kernfragen. Dabei wurden bereits viele unterschiedliche Modelle vorgeschlagen.
Gegenüberstellung: Was spricht dafür? Und was dagegen?
Das Grundeinkommen polarisiert wie kaum ein anderes sozialpolitisches Konzept. Für die einen ist es ein Weg zu mehr Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und sozialem Fortschritt. Die anderen sehen darin eine riskante Illusion mit unklarem Preis.
Die Idee vom BGE berührt zentrale Fragen unseres Zusammenlebens: Wie viel Sicherheit braucht der Mensch – und wie viel Eigenverantwortung? Wie definieren wir Arbeit? Wer verdient was – und warum? Es geht also nicht nur um Geld, sondern um Grundhaltungen, Werte und das Selbstbild einer Gesellschaft im Wandel.
Mögliche Vorteile: Sicherheit, Freiheit, weniger Bürokratie
Menschen könnten ohne Existenzangst leben und ihr Leben freier gestalten. Weniger Stress und dadurch mehr mentale Gesundheit wären möglich.
Armut und existenzielle Notlagen könnten verhindert werden.
Alle würden gleich behandelt, unabhängig von ihrer Bedürftigkeit.
Erwerbslose würden weniger stigmatisiert.
Die Berufswahl könnte stärker nach Interessen und Sinn statt nach Einkommen erfolgen.
Mehr Menschen könnten sich ehrenamtlich oder kreativ engagieren.
Fortschritte bei der Gleichstellung könnten möglich sein, da Teilzeit in der Familie anders verteilt würde.
Die finanzielle Grundsicherung könnte nachhaltige Entscheidungen erleichtern.
In Zeiten von Klimawandel und beruflichem Wandel durch Künstliche Intelligenz könnte das BGE ein neues soziales Fundament bilden.
Die staatliche Bürokratie könnte verschlankt werden, weil viele heutige Sozialleistungen ersetzt würden.
Mögliche Nachteile: Kosten, Motivation, soziale Gerechtigkeit
Ein BGE in realistischer Höhe wäre extrem teuer und mit Einschnitten an anderer Stelle verbunden. Der Sozialstaat wäre je nach Ausgestaltung weitgehend abgeschafft.
Eine Finanzierung über höhere Einkommensteuern könnte Arbeitsanreize schwächen.
Bei einer möglicherweise notwendigen Mehrwertsteuererhöhung würde der Konsum gebremst und Geringverdienende belastet werden.
Weniger Menschen könnten bereit sein zu arbeiten; manche würden sich komplett vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Der Fachkräftemangel würde sich verschärfen. Unbeliebte, aber notwendige Berufe könnten unbesetzt bleiben.
Die Wirtschaftsleistung könnte insgesamt sinken.
Das BGE würde auch an Menschen gezahlt, die es nicht brauchen – das empfinden viele als ungerecht. Es droht Missbrauch durch „Leistungsunwillige“.
Gleiche Beträge für alle ignorieren regionale Unterschiede bei Lebenshaltungskosten.
Eine sanktionsfreie Mindestsicherung oder eine andere Zahlung nur an Bedürftige betrachten viele Kritikerinnen und Kritiker als gezielter und fairer.
Wie könnte das Grundeinkommen finanziert werden?
Die Finanzierung bleibt eine der Kernfragen bei der Diskussion um ein BGE: Ließe sich ein bedingungsloses Einkommen überhaupt finanziell stemmen? Und wenn ja, wie und wo werden dafür Abstriche gemacht? Dabei gibt es vor allem 4 Ansätze.
- Steuerfinanziertes Modell
Beim klassischen Ansatz würde das BGE über höhere oder neu gestaltete Steuern finanziert, etwa durch eine Einkommens- oder Vermögenssteuer. Meist sollen höhere Einkommen deutlich stärker besteuert werden als niedrige.
- Vorteil: Das Modell nutzt bestehende Steuerstrukturen, ist administrativ vergleichsweise einfach und kann Umverteilung fördern.
- Nachteil: Es könnte den politischen Widerstand wohlhabender Gruppen hervorrufen. Es birgt außerdem das Risiko, dass Arbeitseinkommen zu stark besteuert wird. Dadurch hätten Menschen womöglich weniger Anreiz, dennoch zu arbeiten.
- Konsum- und Umweltabgaben
Einige Befürwortende schlagen vor, das BGE teilweise durch höhere Mehrwertsteuern oder Ressourcensteuern zu finanzieren. Beispielsweise werden Abgaben auf Energieverbrauch, CO₂-Ausstoß oder den Einsatz nicht erneuerbarer Rohstoffe vorgeschlagen.
- Vorteil: Diese Form der Finanzierung könnte ökologische Lenkungswirkungen entfalten und nachhaltiges Verhalten fördern.
- Nachteil: Da Konsumsteuern alle Menschen gleichermaßen treffen, belasten sie tendenziell einkommensschwache Haushalte stärker.
- Umverteilung bestehender Sozialleistungen
Ein weiterer Ansatz wäre, das BGE zumindest teilweise durch die Abschaffung oder Zusammenlegung bestehender Sozialleistungen zu finanzieren.
- Vorteil: Das Sozialsystem würde deutlich vereinfacht, Bürokratie abgebaut und Verwaltungsaufwand reduziert.
- Nachteil: Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf könnten schlechter gestellt werden, wenn individuelle Hilfen wegfallen.
- Finanztransaktions- und Automatisierungssteuern
In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft wird auch die Besteuerung von Finanztransaktionen oder dem Einsatz von Robotern und Künstlicher Intelligenz diskutiert. Ziel wäre, Produktivitätsgewinne durch Automatisierung zu verteilen.
- Vorteil: Dieses Modell reagiert auf strukturelle Veränderungen der Wirtschaft und könnte Einkommensverluste durch technologischen Wandel ausgleichen.
- Nachteil: Die Umsetzung ist komplex, international schwer abzustimmen und birgt das Risiko von Kapitalflucht oder Standortverlagerungen.
Denkbar wäre auch eine Mischform aus mehreren dieser Ansätze
Die größte Herausforderung würde darin bestehen, ein Finanzierungssystem zu entwickeln, das gerecht, nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig ist. Dabei dürfte außerdem die Grundidee des BGE, nämlich Freiheit und Sicherheit für alle, nicht gefährdet werden.
Bisherige Erfahrungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen
Weltweit gibt es bislang kein Land, das ein bedingungsloses Grundeinkommen flächendeckend und dauerhaft eingeführt hat. Allerdings gibt es zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Modellversuchen. Diese fanden in der Regel über begrenzte Zeiträume statt, um die Wirkung eines BGE auf die Betroffenen zu testen.
Im Folgenden stellen wir 2 dieser Projekte vor. Beide haben einer ausgewählten Personengruppe 3 Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlt. Beim ersten Projekt handelt es sich um den bisher größten Versuch in Deutschland. Beim zweiten um eine noch größer angelegte Studie, die in den USA durchgeführt wurde.
Pilotprojekt in Deutschland: 3 Jahre Grundeinkommen
In Deutschland wurde das Konzept im privat organisierten, spendenfinanzierten Pilotprojekt Grundeinkommen getestet. Dabei erhielten 122 berufstätige Erwachsene in den Jahren 2021 bis 2024 monatlich 1.200 Euro – zusätzlich zu ihrem Einkommen, ohne Bedingungen. Die Teilnehmenden mussten zur Bewerbung ein Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1.100 und 2.600 Euro monatlich aufweisen. Gleichzeitig wurde eine Vergleichsgruppe mit 1.580 Menschen ohne BGE beobachtet. Die Ergebnisse der ersten deutschen Langzeitstudie zum Grundeinkommen wurden 2025 veröffentlicht.
Organisiert wurde das spendenfinanzierte Projekt vom Verein „Mein Grundeinkommen“. Die wissenschaftliche Begleitung übernahmen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), die Wirtschaftsuniversität Wien und die Universität zu Köln. Was die Studie besonders bemerkenswert macht, sind einige Ergebnisse, mit denen so kaum jemand gerechnet hätte:
- So arbeiteten die Teilnehmenden sowohl ohne als auch mit Grundeinkommen im Schnitt weiterhin 40 Stunden pro Woche.
- Teilnehmende mit Grundeinkommen sparten im Monat durchschnittlich rund 450 Euro mehr als die Vergleichsgruppe.
- Teilnehmende mit BGE konsumierten nur etwas mehr als die Vergleichsgruppe. So gaben sie beispielsweise im Mittel über den gesamten Studienzeitraum 177 Euro mehr für Urlaub aus, 40 Euro mehr für Freizeit und 34 Euro mehr für Kleidung.
- Teilnehmende mit BGE widmeten sich häufiger Weiterbildungsmaßnahmen.
- Die Teilnehmenden mit BGE gaben mit durchschnittlich 28 Euro monatlich mehr als doppelt so viel Geld wie die Vergleichsgruppe (12 Euro) für Spenden aus. Eine höhere Spendenbereitschaft blieb selbst nach Ende der Auszahlungen des BGE bestehen.
- Außerdem gaben die Teilnehmenden mit BGE mit durchschnittlich 126 Euro mehr als doppelt so viel Geld wie die Vergleichsgruppe (50 Euro) aus, um Freundinnen, Freunde und Familie finanziell zu unterstützen.
- Die Teilnehmenden mit BGE äußerten sich als deutlich zufriedener mit ihrem Einkommen und ihrem Arbeitsleben.
Die gemeinnützige Organisation „Mein Grundeinkommen“ verlost regelmäßig Grundeinkommen. Die nächste Verlosung ist für den 26. November 2025 geplant. Dabei gibt es insgesamt 25 Grundeinkommen zu gewinnen. Die Organisation testet im Rahmen von Studien weiterhin die Auswirkung bedingungsloser Einkommen auf die Betroffenen.
Pilotprojekt in den USA: 3 Jahre Grundeinkommen
Die Forschenden Eva Vivalt, Elizabeth Rhodes, Alexander W. Bartik, David E. Broockman, Patrick Krause und Sarah Miller (verschiedene Universitäten) haben in den USA einen noch wesentlich größeren Modellversuch durchgeführt. Insgesamt 1.000 Personen erhielten über 3 Jahre ein monatliches Grundeinkommen von 1.000 US-Dollar. Finanziert wurde das Projekt vom BGE-Befürworter und OpenAI-Gründer Sam Altmann. Bei den Teilnehmenden handelte es sich um Menschen mit eher niedrigem Einkommen. Durchschnittlich umfasste das BGE 40 Prozent des eigenen Einkommens.
Für die bessere Vergleichbarkeit bekam eine Kontrollgruppe 50 US-Dollar pro Monat. Die Ergebnisse wurden 2024 veröffentlicht:
- Die Testpersonen, die ein BGE erhielten, gaben im Vergleich zur Kontrollgruppe monatlich etwa 300 US-Dollar mehr aus. Die höheren Ausgaben umfassten fast alle Konsumbereiche, vor allem aber Wohnen, Lebensmittel und das Auto.
- Die Testpersonen mit BGE erzielten gegenüber der Kontrollgruppe leicht höhere Vermögenswerte. Doch gleichzeitig verschuldeten sie sich auch stärker. Wird das verrechnet, veränderte sich die Vermögenslage durch das BGE kaum.
- Sie reduzierten ihr aus Arbeit erzieltes Einkommen um rund 5 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe.
- Sie verbrachten 1,3 bis 1,4 Stunden pro Woche weniger mit beruflicher Arbeit als die Kontrollgruppe.
- Sie investierten nicht stärker in Weiterbildung als die Kontrollgruppe.
- Es gab keine langfristige Verbesserung der Gesundheit oder Lebenszufriedenheit. Gemessen wurde dies anhand von Blutuntersuchungen, Fragebögen oder einer App.
Vergleich der Ergebnisse aus beiden Projekten
Prinzipiell sind die deutsche und die amerikanische Studie ähnlich konzipiert. Finanziell betrachtet lagen auch die durchschnittlichen beruflichen Einkommen der Teilnehmenden in beiden Projekten in einem ähnlichen Bereich. Warum die Ergebnisse so unterschiedlich ausfallen, lässt sich letztlich nur spekulieren.
Möglicherweise besteht unter anderem ein Zusammenhang zum gesellschaftlichen Hintergrund. So war die amerikanische Zielgruppe ein schwächeres soziales Sicherungsnetz gewöhnt. 3 Jahre sichere monatliche Einnahmen wurden dadurch eventuell verstärkt für dringende Ausgaben verwendet: für Reparaturen, Miete, Lebensmittel oder das Auto. Solche Ausgaben erscheinen in der Statistik als höherer Konsum. Sie könnten aber notwendig gewesen sein, um den Alltag erst einmal zu stabilisieren.
Die deutsche Zielgruppe war hingegen einen Sozialstaat gewöhnt, der beispielsweise weitreichende Leistungen bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit bietet. Sie war damit bereits für den Bedarfsfall sozial abgesichert und erhielt das BGE zusätzlich. Wer bereits eine gewisse Sicherheit hat, kann eher langfristig agieren. Das zusätzliche Geld diente daher möglicherweise weniger der akuten Entlastung als der langfristigen Gestaltung: Viele sparten, bildeten sich weiter oder widmeten sich der Familie oder persönlichen Projekte. Weitere Studien sind bereits in Planung.
Die Grundsicherung – etwa das heutige Bürgergeld – richtet sich an Menschen mit geringem oder keinem Einkommen. Sie ist antrags- und bedarfsabhängig und greift dann, wenn das eigene Einkommen nicht zum Leben reicht.
Ein Grundeinkommen wäre dagegen bedingungslos und würde allen Bürgerinnen und Bürgern automatisch ausgezahlt – unabhängig davon, ob diese arm oder reich sind. Es soll nicht nur absichern, sondern grundlegende Teilhabe ermöglichen.
Machen Sie mehr aus Ihrem Geld
Häufige Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen
In der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen gibt es unterschiedliche Modelle. Diese sehen monatliche Auszahlungen in verschiedener Höhe vor. In Deutschland reichen die diskutierten Beträge von etwa 600 bis 1.500 Euro pro Monat für Erwachsene, abhängig vom Modell. Im „Pilotprojekt Grundeinkommen“ erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 2021 bis 2024 beispielsweise 1.200 Euro monatlich.
Der Verein „Mein Grundeinkommen“ verlost regelmäßig Grundeinkommen. Die Verlosungen finden unregelmäßig statt. Voraussetzung ist, dass genügend Spenden gesammelt wurden, um eine bestimmte Anzahl an Grundeinkommen zu finanzieren.
Weltweit gibt es bislang kein Land, das ein bedingungsloses Grundeinkommen flächendeckend und dauerhaft eingeführt hat. In mehreren Staaten liefen jedoch Pilotprojekte – so etwa in Finnland, den Niederlanden, Spanien, Kanada, Kenia, Namibia, Indien und Brasilien. Diese Versuche sind in der Regel zeitlich befristet, regional begrenzt und richten sich an ausgewählte Bevölkerungsgruppen.
Bei vielen Modellen bekommen die Teilnehmenden zum Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit zusätzlich das bedingungslose Grundeinkommen. Dieses wird grundsätzlich unabhängig vom sonstigen Einkommen gezahlt und nicht – wie bei bisherigen Sozialleistungen – auf Erwerbseinkommen angerechnet.
Um ein bedingungsloses Einkommen in der Praxis finanzieren zu können, würden allerdings je nach Ausgestaltung wesentlich höhere Steuern nötig sein. In der Praxis könnte dieses also für viele ein zusätzliches Einkommen darstellen. Für alle mit hohen Einkommen wäre es aber durch die höheren Steuern möglicherweise kein realer finanzieller Zugewinn mehr.