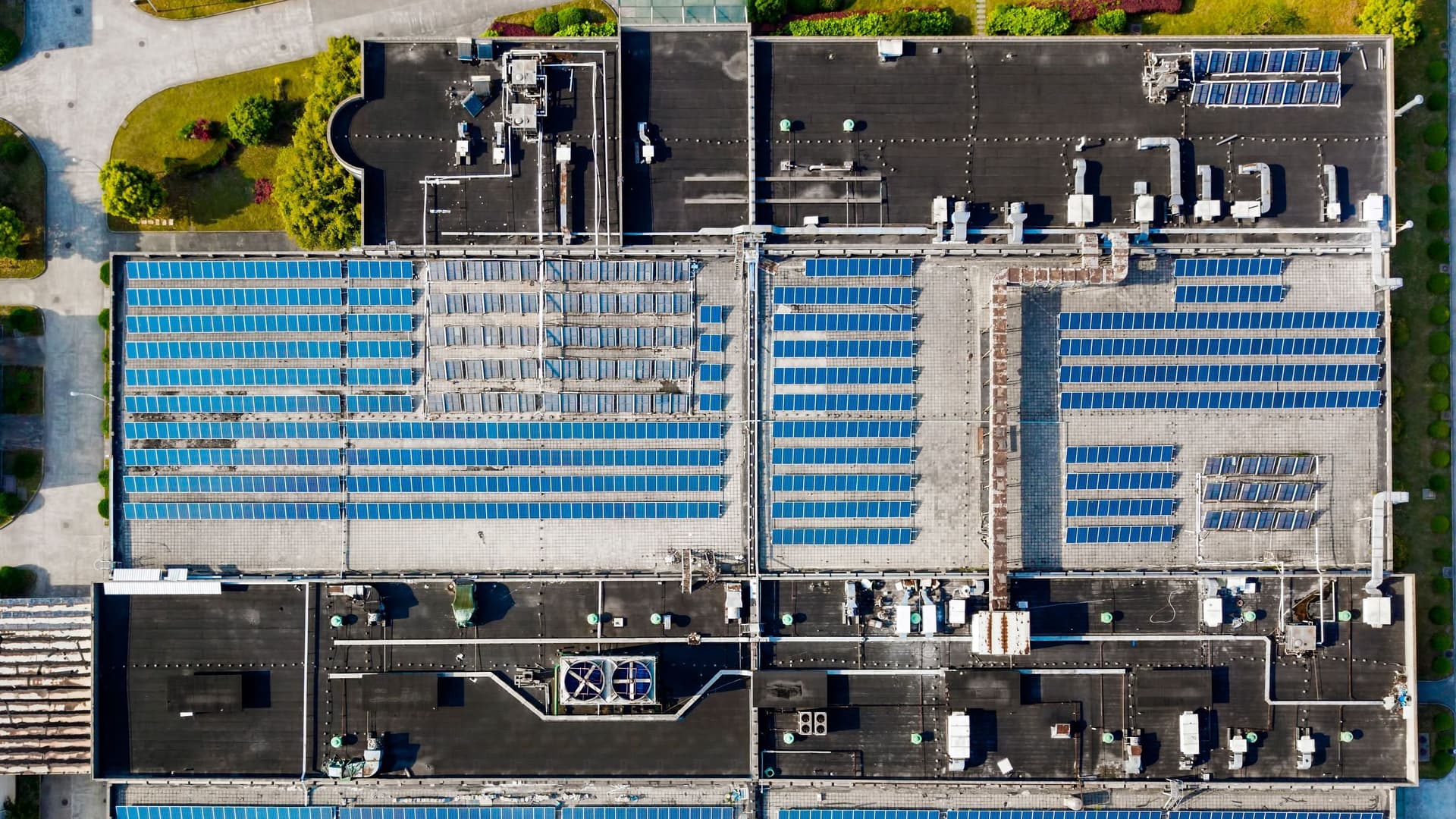Grüner Wasserstoff gilt als „Champagner der Energiewende“.
Ganze Industriezweige wie die Stahlproduktion, Wärmeversorgung oder Mobilität wollen künftig von dem grünen Gas profitieren.
Aber die Herstellung von Wasserstoff ist energie- und kostenintensiv. Technologischer Fortschritt, Skaleneffekte sowie Investitionen und Förderprogramme sollen seine Rolle als Hoffnungsträger der Energiewende vorantreiben.
Wasserstoff gilt als zentraler Baustein der Energiewende
Besonders die grüne Variante des Wasserstoffs – hergestellt mittels Sonne, Wind oder Wasserkraft – trägt dazu bei, Emissionen drastisch zu reduzieren und langfristig klimaneutral zu wirtschaften. Der vielseitige Energieträger hat aber nicht nur das Potenzial, fossile Brennstoffe zu ersetzen, sondern bietet Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung. Deutschland fördert daher den Auf- und Ausbau der Wasserstofftechnologie mit einer nationalen Strategie und zahlreichen Projekten. Die Aktivitäten reichen von lokalen Pilotprojekten bis hin zu internationalen Partnerschaften. Doch wie kann Wasserstoff konkret den wirtschaftlichen Wandel unterstützen?
Wasserstoff gibt es auf der Erde reichlich. Von Natur aus ein farbloses Gas, kommt er fast ausschließlich in chemischen Verbindungen wie Wasser, Säuren oder Kohlenwasserstoffen vor. Um Wasserstoff in seiner reinen Form (H₂) nutzen zu können, muss er aus diesen Verbindungen mithilfe von Energie herausgelöst werden. Ob dabei umweltfreundlicher Wasserstoff entsteht, hängt davon ab, welche Energiequelle dafür genutzt wird. Grün wird er, wenn der Strom für seine Herstellung aus erneuerbaren Energien, sogenannten grünen Energien, kommt. Bei seiner Herstellung entstehen dann keine schädlichen Treibhausgase.
Markt oder Massenproduktion – das Henne-Ei-Problem
Thomas von Unwerth, Professor für Alternative Fahrzeugantriebe an der Technischen Universität Chemnitz, geht mit gutem Beispiel voran: Mit seinem Brennstoffzellen-Pkw hat er in drei Jahren schon rund 90.000 Kilometer zurückgelegt. Etwa 100 Wasserstofftankstellen gebe es bereits in Deutschland. Den Gesamtbedarf schätzt er auf 400 Tankstellen. Für eine Beschleunigung des Aufbaus einer Wasserstoffwirtschaft engagiert sich von Unwerth auch in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des Wasserstofftechnologie-Clusters HZwo in Chemnitz, wo in den nächsten Jahren das nationale Innovations- und Technologiezentrum für Wasserstoff (ITZ) entstehen soll. Bundesministerien und der Freistaat Sachsen fördern den Aufbau mit insgesamt 87,5 Millionen Euro.
Wasserstoff bisher eine Nischenlösung?
H2 hat das Potenzial, als nachhaltiger Energieträger viele Branchen zu revolutionieren – doch bisher bleibt er eine Nischenlösung. Es sei das Problem von Henne und Ei, erläutert der Professor: „Für günstige Preise müssen Komponenten im großen Serienmaßstab produziert werden – dafür ist ein entsprechender Markt erforderlich.“ Die Stückzahlen der technischen Komponenten für Herstellung und Verbrauch von Wasserstoff seien noch zu gering.
Es ist jedoch keineswegs so, dass mit der Wasserstofftechnologie noch keine Umsätze erzielt würden. Die SITEC Industrietechnologie GmbH mit Sitz in Chemnitz zählt als Maschinen- und Anlagenbauer zu den exportstarken mittelständischen Unternehmen. Darüber hinaus hat sich die Serienproduktion von Komponenten und Bauteilen seit mehr als 20 Jahren zu einem wichtigen Geschäftsfeld entwickelt. Basierend auf der Kerntechnologie von SITEC, dem Laserschweißen, sind es zunehmend Bipolarplatten und Interkonnektoren, die für Elektrolyseure oder Brennstoffzellensysteme benötigt werden.
Die Art der Wasserstoffproduktion bestimmt seine sogenannte „Farbe“. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt. In diesem Prozess wird Wasser in einem sogenannten Elektrolyseur in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Ablauf wird auch als Power-to-Gas-Verfahren bezeichnet. Er darf sich grün nennen, wenn er ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- oder Sonnenenergie betrieben wird. Die Produktion von grünem Wasserstoff ist dann CO₂-frei.
Von der Nische zur Schlüsselindustrie – Unternehmen mischen mit
Auch SITECs Geschäftsführer Dr. Jörg Lässig ist überzeugt vom Energieträger H2: „Wir investieren massiv Geld und Ressourcen und sind damit auch international in Europa und Asien erfolgreich. Für uns ist das ein strategisches Geschäft, in dem wir nennenswert Umsätze erzielen.“ Auch wenn der Anteil am Gesamtumsatz noch sehr gering sei. „Aber die Wasserstoffindustrie wird sowohl in Europa als auch in China deutlich wachsen. In wenigen Jahren erwarten wir deshalb siebenstellige Umsatzbeiträge.“ Der Maschinenbauingenieur fügt hinzu: „Wir wollen nicht einen Teil des Kuchens haben, sondern ihn mitbacken.“
Allerdings gebe es noch einige Hürden zu überwinden: „In Deutschland tun wir uns schwer, weil wir hier das Thema meisterlich zerreden, uns in argumentativen Details verlieren und keinen Weg finden, dafür in der Breite Verständnis, Interesse und Motivation zu schaffen. Wir forschen zwar, streiten uns aber im Kleinen über die Sinnfälligkeit, und dabei merken wir nicht, dass andere Länder uns da im Wettbewerb überholen.“ Ihm fehle ein nationaler Plan, eine Leitlinie zur kommerziellen Umsetzung des Themas. „Es ist bisher nicht in der Wertschöpfung der Unternehmen angekommen. Einige tun etwas, aber das hat nicht die Größenordnung, die es haben könnte, wenn ich mir andere europäische Regionen, wie etwa Skandinavien, Frankreich oder das Baltikum anschaue.“
Im Video: Wie das Unternehmen SITEC von der Wasserstoffwende profitiert – und sie vorantreibt
Auf die Verarbeitung der Daten durch Google haben wir keinen Einfluss. Google übermittelt Ihre Daten möglicherweise in Länder ohne der EU gleichwertiges Datenschutzniveau (z. B. USA). Informationen finden Sie in der Google-Datenschutzerklärung.
Die wichtigsten Vor- und Nachteile von Wasserstoff im Überblick
Klimafreundlichkeit: Grüner Wasserstoff ist ein klimafreundlicher Energieträger, da bei seiner Herstellung durch Elektrolyse mit erneuerbarem Strom kein CO₂ ausgestoßen wird. Allerdings ist er nur dann wirklich klimaneutral, wenn der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt.
Energiespeicherung: H₂ kann überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarstrom speichern und bei Bedarf wieder nutzbar machen. Dadurch trägt er zur Netzstabilität bei.
Vielseitigkeit: Grüner Wasserstoff kann als Brennstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge, als Rohstoff in der chemischen Industrie oder in der Stahlproduktion genutzt werden. Er ermöglicht so die Dekarbonisierung verschiedener Sektoren.
Unabhängigkeit: Durch die Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kann die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert werden. Gleichzeitig könnten Länder mit hoher erneuerbarer Stromerzeugung zu Exporteuren werden.
Skalierbarkeit: Die Produktion von grünem Wasserstoff kann durch den Ausbau erneuerbarer Energien gesteigert werden.
Kosten: Die Herstellung von grünem H₂ ist derzeit noch teurer als fossile Alternativen wie Erdgas oder grauer Wasserstoff. Kostensenkungen werden durch technologischen Fortschritt und Skaleneffekte erwartet.
Infrastruktur: Für die Herstellung, den Transport und die Speicherung von Wasserstoff ist eine spezielle Infrastruktur notwendig. Wasserstoffleitungen, Speicherlösungen und Verteilernetze müssen erst ausgebaut werden.
Abhängigkeit: Deutschland wird voraussichtlich rund 70 Prozent seines Wasserstoffbedarfs importieren müssen, da die inländische Produktion den Bedarf nicht decken kann. Potenzielle Importländer sind Regionen mit hoher erneuerbarer Stromerzeugung wie Nordafrika oder Australien. Gleichzeitig werden Wasserstoff-Hubs in Europa (z. B. Nord- und Ostsee) erforscht.
Umwandlungsverluste: Bei der Elektrolyse, der Speicherung, dem Transport und der Rückverstromung von Wasserstoff kommt es zu erheblichen Energieverlusten. Daher ist die direkte Nutzung von Strom oft effizienter.
In unserem Whitepaper „Wasserstoff: Schlüssel zu einer klimaneutralen Wirtschaft“ finden Sie vertiefende Infos zum Thema grüner Wasserstoff und weitere Unternehmensbeispiele. Sie finden dort auch Antworten auf die Fragen, ob Deutschland seinen Bedarf an grünem Wasserstoff decken kann und wie sich der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft finanziell stemmen lässt.
Tool hilft beim Planen von Projekten rund um Wasserstoff
Wie komplex die Planung von Wasserstoffprojekten ist, zeigt eine Software, die der Wirtschaftsingenieur Konrad Uebel mit seinem Freiberg-Institut auf den Markt gebracht hat. Das Tool namens Edgar hilft beim Planen von Projekten rund um den Energieträger Wasserstoff. Anwender sind Wasserstoffproduzenten (Elektrolyseure), Energieversorger, Stadtwerke, Transportunternehmen, Flottenbetreiber und Fährbetriebe. Der Marktpreis für Strom, essenziell für das Verfahren zur Trennung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, reagiere extrem sensibel auf Angebotsschwankungen und schlage auf den Wasserstoffpreis durch, weshalb eine gezielte Nutzung Niedrigpreisphasen essenziell für den wirtschaftlichen Erfolg sei, erläutert Uebel. „Unsere Kunden können einen digitalen Zwilling der geplanten Anlage erstellen und beispielsweise ein Jahr im Minutentakt simulieren. Pro Projekt erzeugen wir eine halbe Milliarde Datenpunkte.“ Machbarkeitsstudien als Grundlage für Investitionsentscheidungen wie etwa in eine Betriebstankstelle müssten hoch dynamische und nicht standardisierbare Rahmenbedingungen berücksichtigen – „genau dafür dient unser Werkzeug“. Seitens der Politik wünscht sich Uebel „Verlässlichkeit und eine Regulatorik, die das schnelle Vorankommen ermöglicht und nicht erschwert“.
Reges Interesse: Maschinenbauingenieur bietet eigenen Brennstoffzellen-Lkw an
Der Zwickauer Fahrzeug-Entwicklungsdienstleister FES GmbH hat nicht auf öffentliche Fördermittel gewartet, sondern gleich selbst einen Brennstoffzellen-Lkw gebaut. Über mangelndes Interesse potenzieller Kundinnen und Kunden kann sich der Fahrzeug- und Maschinenbauingenieur Projektleiter Felix Herrmann nicht beschweren. Aber er sieht politische Umstände als Innovationsbremse: „Die aktuelle politische Situation spielt gegen uns: Es stand in Aussicht, dass Lkw-Käufer 80 Prozent des Mehrpreises gegenüber einem konventionellen Diesel-Lkw als Förderung bekommen – aber dafür sind jetzt keine Haushaltsmittel eingeplant, und jeder Interessent zögert. Wir würden ja gern, sagen viele, aber vielleicht gibt es ja nach Februar wieder die Förderung, und dann haben wir 300.000 bis 400.000 Euro in den Sand gesetzt.“ Für Herrmann steht trotzdem außer Frage, dass die Wasserstoffwirtschaft früher oder später auch in der Breite ankommen wird. So rundet der Maschinenbauingenieur seine Ausführungen mit einem Hinweis auf das Henne-Ei-Problem ab – wo kein Markt, da keine Innovationen, und umgekehrt. In diesem Fall ergänzt um den Zusatz: „Wir haben uns des Eies angenommen.“
Häufige Fragen zum grünen Wasserstoff
Die Vorteile von grünem Wasserstoff liegen auf der Hand: Er verbrennt sauber, lässt sich gut speichern und transportieren. Grüner Wasserstoff unterstützt den Klimaschutz, könnte eine sichere Energieversorgung unterstützen und Deutschland dabei helfen, bis 2045 klimaneutral zu werden. „Investitionen in Wasserstoff sind eine Investition in unsere Zukunft ...,“ sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) anlässlich der Vorstellung der Nationalen Wasserstoffstrategie. Durch unter anderem die europäische und die deutsche Nationale Wasserstoffstrategie soll die Wasserstofftechnologie massiv gefördert und künftig eine der tragenden Säulen der Energiewirtschaft werden.
Um grünen Wasserstoff zu gewinnen, muss Wasser (H2O) in Sauerstoff (O2) und Wasserstoff (H2) gespalten werden. Wird dafür elektrischer Strom verwendet, spricht man von Elektrolyse.
Stand 21. Februar 2025